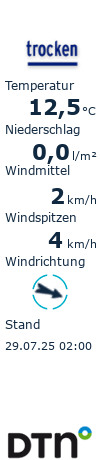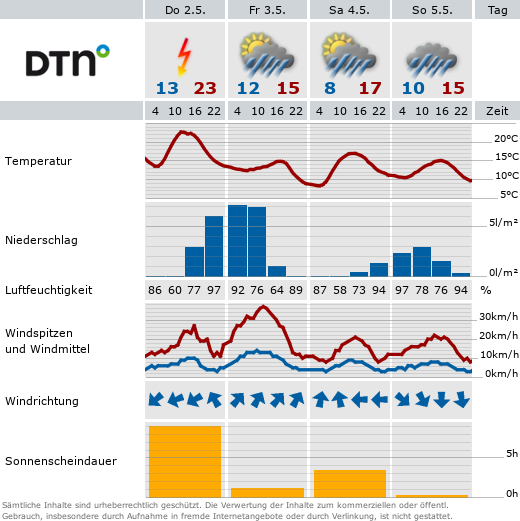Das Sprachtherapeutische Ambulatorium (SpA) gehört zum Fachgebiet Sprache und Kommunikation.
Willkommen auf den Seiten des Sprachtherapeutischen Ambulatoriums
Das Sprachtherapeutische Ambulatorium (SpA) ist eine Lehr-, Forschungs- und Serviceeinrichtung des Fachgebiets Sprache und Kommunikation der Fakultät Rehabilitationswissenschaften. Gemeinsam mit den derzeit vier weiteren Lehr- und Forschungsambulanzen (BwA, UK-Netzwerk, PPA und seki) bildet das SpA das Zentrum für Beratung und Therapie (ZBT). Das SpA ist zugelassener Leistungserbringer für das Heilmittel Sprachtherapie. Die Arbeit des SpA wird durch den Förderverein SpA.V unterstützt.
Die Angebote des SpA richten sich an Familien von Kindern und Jugendlichen mit Sprech-, Sprach- und Kommunikationsstörungen und an interessierte Studierende der Fakultät Rehabilitationswissenschaften. Wir bieten Fachpersonen unterschiedlicher Disziplinen durch unsere Fortbildungen eine professionelle Unterstützung für ihre sprachtherapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an.
Das ZBT und seine Ambulanzen





Nachrichten aus dem ZBT
40 Jahre Lernen - Lehren - Forschen
Das Jahr 2024 ist für das Sprachtherapeutische Ambulatorium ein Jubiläumsjahr. Seit seiner Gründung vor vier Jahrzenten bietet das SpA qualitativ…

Freie Praktikumsplätze im BwA
Haben Sie Interesse an einem studienbegleitenden Praktikum im Bewegungsambulatorium?

Das BwA-Team bekommt Verstärkung
Das BwA-Team heißt Alexandra Bültmann als Therapeutin im Bewegungsambulatorium herzlich willkommen!

Treffen von UK-Expert*innen an der TU Dortmund
Am 10.04.2024 trafen sich Vertreter*innen von Dortmunder vorschulischen Einrichtungen, von Förderschulen aus Dortmund und Bochum sowie dem…

Netzwerktreffen Frühe Hilfen Dortmund
Am 06.03.2024 traf sich das Netzwerk "Frühe Hilfen" der Stadt Dortmund in den Räumen des Gesundheitsamtes. Das Netzwerk tagt drei bis vier Mal im…

Kim Lipinski zurück im BwA-Team
Das BwA-Team freut sich, dass Kim Lipinski nach eine Pause wieder als Therapeutin im Bewegungsambulatorium tätig sein wird.

Das ZBT beim 19. Kontakttag der Fakultät
Auch 2023 war das ZBT wieder mit einem Infostand auf dem Kontakttag der Fakultät Rehabilitationswissenschaften vertreten. Neben zahlreichen regionalen…

Neue Mitarbeiterin im SpA-Team
Das SpA-Team heißt Lisa Röbstek als neue Mitarbeiterin und Therapeutin im Sprachtherapeutischen Ambulatorium herzlich willkommen!